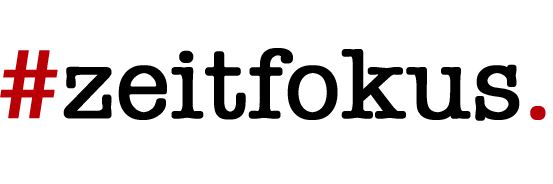Trumps zweite Staffel
Vier Jahre ist es her, dass ein gnadenloser Populist und Selbstdarsteller die goldene Rolltreppe im New Yorker Trump-Tower herunterfuhr und unten vor den Kameras Alarm schlug: "Unser Land ist in ernster Gefahr", warnte er vor chinesischer Wirtschaftskonkurrenz und "mexikanischen Vergewaltigern", die das Land angeblich bedrohten. "Der amerikanische Traum ist tot", sagte Donald Trump: "Aber als Präsident werde ich ihn wiederbeleben." Mit genau derselben Masche bewirbt sich der 73-Jährige nun um den Wiedereinzug ins Weiße Haus. Und seine Anhänger fiebern der zweiten Staffel des Polit-Dramas entgegen.

Vier Jahre ist es her, dass ein gnadenloser Populist und Selbstdarsteller die goldene Rolltreppe im New Yorker Trump-Tower herunterfuhr und unten vor den Kameras Alarm schlug: "Unser Land ist in ernster Gefahr", warnte er vor chinesischer Wirtschaftskonkurrenz und "mexikanischen Vergewaltigern", die das Land angeblich bedrohten. "Der amerikanische Traum ist tot", sagte Donald Trump: "Aber als Präsident werde ich ihn wiederbeleben." Mit genau derselben Masche bewirbt sich der 73-Jährige nun um den Wiedereinzug ins Weiße Haus. Und seine Anhänger fiebern der zweiten Staffel des Polit-Dramas entgegen.
Von seinen damaligen Versprechen hat Trump nur wenig eingelöst: Die Einwanderung aus dem Süden, die er mit einer "wunderbaren Mauer" stoppen wollte, erreicht gerade Rekordniveau. Der Handelskrieg mit China schadet den amerikanischen Farmern. Im Nahen Osten droht ein Krieg, den der Isolationist unbedingt vermeiden wollte. Die Straßen im mittleren Westen verkommen, während sich das gigantische Infrastrukturpaket als Fata Morgana entpuppt. Und die Steuerreform hat zwar den Unternehmen geholfen, aber die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter geöffnet. In der nächsten Amtszeit will Trump offenbar wenig anders machen. Seine Rede zum Kampagnenstart in Orlando vergangene Woche enthielt jede Menge Selbstlob, aber keine konkreten Ziele. Die Basis des Präsidenten stört das nicht: Die Mehrheit der republikanischen Wähler steht in Umfragen unverdrossen hinter Trump, seine Kritiker im Kongress sind verstummt, und einen ernsthaften parteiinternen Konkurrenten um das höchste Amt im Staat gibt es nicht.
Das mag verwundern. Doch offensichtlich geht es seinen Anhängern weniger um Inhalte, als um ein Zeichen: Trump ist ihr ausgestreckter Mittelfinger für das System, von dem sie sich ungerecht behandelt und marginalisiert fühlen. Der Milliardär gibt den Rächer der Enterbten und kaschiert seinen Egotrip mit finsteren Ressentiments und konservativen Schlagwörtern als Kulturkampf gegen die Mächte des Bösen. Solange die Wirtschaft gut läuft, scheint das zynische Illusionstheater bei seiner Fangemeinde zu verfangen. Trotzdem haben die Demokraten eine gute Chance, im Herbst des nächsten Jahres das Ruder herumzureißen. Die Konjunktur in den USA zeigt erste Schleifspuren. Und selbst in den internen Umfragen des Weißen Hauses rangiert der Präsident derzeit hinter dem aussichtsreichsten demokratischen Herausforderer Joe Biden. Das sind Momentaufnahmen. Doch noch verfügt Trump über einen Amtsbonus, während Herausforderer wie Pete Buttigieg oder Elizabeth Warren ihre mediale Präsenz noch ausbauen müssen.
Gleichwohl hat Trump nie über seine eingeschworene rechte Basis hinausgestrahlt. Auch die Rede in Orlando zielte nur darauf ab, die Kernklientel bei Stimmung zu halten. In seinem ressentimentbehafteten und streckenweise regelrecht giftigen Vortrag gab es keine präsidiale Geste. Trump will spalten, nicht versöhnen. Das sichert ihm den Zuspruch seiner hartgesottenen Anhänger. Es eröffnet aber zugleich Perspektiven für die Demokraten.
Eine Schlammschlacht mit dem Präsidenten wird sie nicht weiterbringen. Noch schlimmer wäre es, wenn sich ihre 23 Kandidaten im Vorwahlkampf gegenseitig zerfetzen. Stattdessen müssen die Bewerber konkrete politische Angebote für die Unentschlossenen und Wechselwähler entwickeln, ohne dabei ihre eigenen Anhänger zu enttäuschen. Das ist ein schwieriger Spagat. Doch wenn es gelingt, das anständige Amerika zu mobilisieren und vor allem in den Swing-States, die mal demokratisch und mal republikanisch wählen, genügend Menschen an die Urnen zu bringen, kann eine Mehrheit durchaus zustande kommen. Dann wäre der Spuk in 17 Monaten vorbei - aber nur dann.